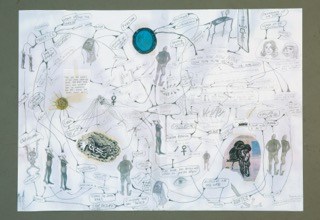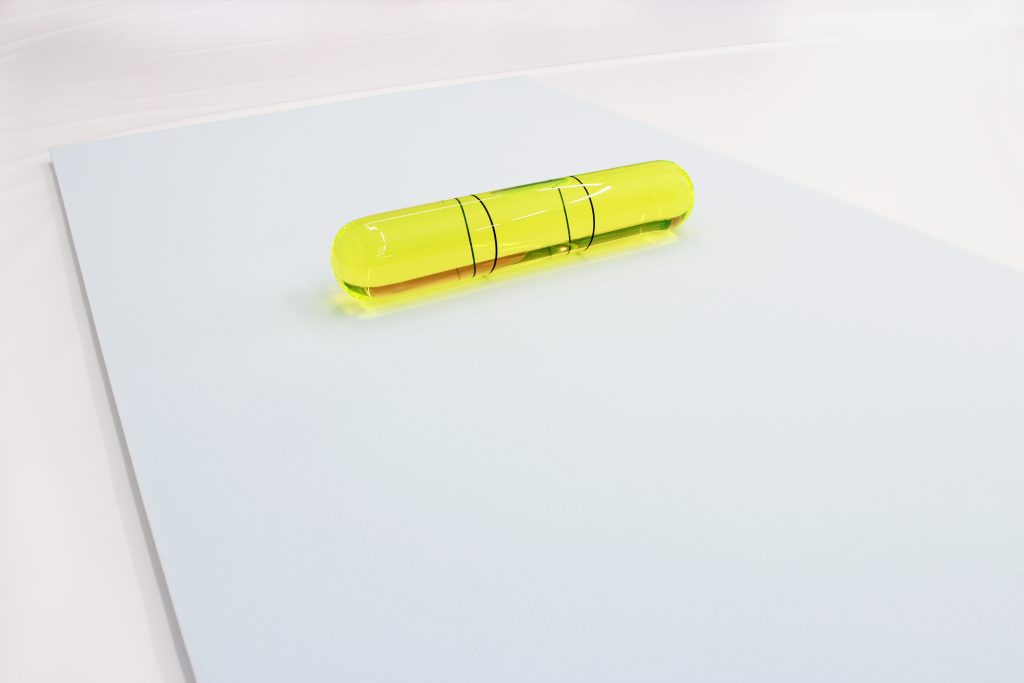Abb. 1: Robert Delaunay, Relief Blanc, 1936, Gips und Kasein auf Metall, 204,00 cm x 109,00 cm, Wien, Museum moderner Kunst.
Eine 193,5 x 96 cm große Metallplatte dient dem Werk als Träger (Abb. 1). Umgeben ist es von einem weißen, abgeschrägten 204,5 x 109 cm großen Rahmen aus Holz. Die drei Zentren der Komposition – welche man auch als Schwingungszentren bezeichnen könnte – bestehen aus Körpern, die sich der Form einer geteilten Halbkugel annähern. Sie sind eingeschrieben in eine hochformatige Ellipse, deren Haupt- und Nebenachse vom rechteckigen Werkformat umfasst werden.
Eines der drei Zentren befindet sich rechts oben, exakt auf der Ellipse gelegen, und wird von dieser zerschnitten. Ein Kugelsegment innerhalb der Ellipse bleibt erhaben, während die Dreidimensionalität jenseits der Ellipsengrenze nur mehr mitgedacht werden kann. Links um dieses Zentrum befinden sich fünf erhabene konzentrische Kreissegmente, die an jener Grenze enden, welche die Halbkugel zerschneidet. Das äußerste dieser Kreissegmente tangiert beinahe den äußersten, ebenfalls fünften, konzentrischen Kreis, welcher um das zweite Zentrum verläuft.
Auch beim zweiten Zentrum ist die linke Hälfte der Halbkugel erhaben. Den Durchschnitt dieser Halbkugel bildet eine schräge Achse, welche oben, ungefähr bei einem Viertel der linken Seite des Werkes beginnt und in der unteren rechten Ecke des Werkes enden könnte, wohin sie aber nicht ganz geführt wird. Sie endet ungefähr auf der Höhe des letzten Viertels der rechten Werkhälfte. Entlang der Achse verdichten sich die Beziehungen der einzelnen Elemente des Werkes, bestehend aus zerschnittener Halbkugel, konzentrischen Kreisen und Ringsegmenten, zueinander.2 An der Achse verschoben, würde das dritte Zentrum das zweite – oder umgekehrt – dahingehend ergänzen, dass es zu einer tatsächlichen Halbkugel würde. Ebenso könnte das Ringsegment rechts der Achse nach unten geklappt werden und so das linke Ringsegment zu einem halben Ring vervollständigen. Es entstünde so ein halber Ring, der sich dann um das dritte Zentrum legen würde. Und so betrachtet findet, im Vergleich zu dem System, das das rechte obere Zentrum umgibt, eine Umkehrung der Verhältnisse statt. Legt sich hier, beim dritten Zentrum also, das grobgekörnte Feld unmittelbar um die zerschnittene Halbkugel, ummantelt es beim ersten Zentrum die konzentrischen Kreise. Diese Schwingungszentren geben radiale Bewegungen von sich; Bewegungen, die miteinander in Kommunikation treten und daher die Zentren nicht als starre, in sich geschlossene Systeme erscheinen lassen. Es ist allerdings die Ellipse – die Assoziationen mit dem Weltenei weckt –, in die sie eingeschrieben sind, die die Expansionsbewegungen über das Bildfeld hinaus zügelt.
Relief Blanc ist eines von insgesamt zweiundzwanzig sogenannten Reliefs, das Robert Delaunay zwischen 1930 und 1936 schuf.3 Es besteht aus Gips und Kasein und ist, wie seinem Titel zu entnehmen ist, weiß. Es wurde 1962 für das Museum des 20. Jahrhunderts, damals unter der Leitung von Werner Hofmann, erworben und befindet sich heute in der Sammlung des Museums moderner Kunst in Wien.
Ein Jahr vor der Entstehung des Reliefs, 1935, fand in Paris der erste Salon de l’art mural statt. Delaunay war Mitglied der Jury.4 Der belgische Künstler Georges Vantongerloo forderte im Katalog zum Salon die Vereinigung von Architektur, Malerei und Skulptur, welche er als „éléments inséparables“ bezeichnete und Amedée Ozenfant proklamierte an selber Stelle, dass die Wände nach den KünstlerInnen riefen.5 Die etablierte Trennung von Malerei, Architektur und Skulptur sollte aufgehoben werden, die Kunst als Teil der Architektur sollte öffentlich werden und nicht mehr nur an Ausstellungsräume gebunden sein. Das Relief konnte an dieser Stelle eine vermittelnde Funktion zwischen Malerei, Skulptur und Architektur einnehmen. Durch seine Gebundenheit an die Fläche war es lange als Architekturornament zum Einsatz gekommen, ein Umstand, der sich im 20. Jahrhundert allerdings ändern sollte. Nicht BildhauerInnen sondern MalerInnen waren es, die zu dieser Neuauffassung wesentlich beitrugen, unter anderem auch wegen der Verwendung von Materialien wie etwa Draht, Kork und anderen, die bislang nicht für Reliefs vorgesehen waren.6
Delaunays Werk entstand zu einem Zeitpunkt, als in Frankreich l’art mural an Bedeutung gewann. Dies ging mit der Krise des Tafelbildes einher. Der französische Kunsthistoriker Pascal Rousseau sieht für diese Krise ökonomische Gründe. Die Weltwirtschaftskrise 1929 soll, so argumentiert er, unmittelbar Einfluss auf die KünstlerInnen und den Kunstmarkt gehabt haben, die sich zusehends von dem traditionellen Tafelbild abwandten und sich einem größeren Format widmeten, das vor allem im art mural wurzelte. Vom Staat finanzierte Auftragsarbeiten – wie jene Delaunays für das Palais du chemin de fer 1937 –, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten, sollten so für die Gesellschaft einheitsstiftend wirken. Der Präsident des Salon de l’art mural Reginald Schoedelin verlautbarte 1936: „Le mur est une tribune – la seule d’où il soit possible de parler directement aux masses.“7 Einzig die Wandmalerei könne, seiner Meinung nach, eine ganze Öffentlichkeit ansprechen und so eine Beziehung zwischen KünstlerIn und BetrachterIn herstellen.8
Zugleich sollten solche monumentalen Arbeiten, wie Delaunays Ausstattung für das Palais du chemin de fer (mit 780m2 sein wohl größtes Werk), auch unter den KünstlerInnen eine neue Einheit konstituieren und dadurch die Synthese aus Malerei und Architektur abermals betonen.9 Delaunay selbst hob dies im Rahmen einer von ihm geführten Gesprächsreihe am 16. Februar des Jahres 1939 hervor und sagte: „Vous voyez les possibilités qu’il y a de travail en équipe […]; il y a des possibilités immenses de travail collectif qui peuvent avoir une énorme importance sur le plan social. […] On peut donc arriver à faire de la peinture en fonction de l’architecture et je crois que c’est la vraie place de peinture qui a commencé à être constructive.“10
Auch andere Künstler wie Albert Gleizes und Georges Vantongerloo kommentierten das Ende des Tafelbildes. Gleizes hob hervor, dass das Tafelbild die eigentliche Essenz der Malerei verfehle; insofern nämlich, als es auf ein einzelnes Individuum bezogen bliebe, auf die je einzelnen BetrachterInnen hin ausgerichtet sei und nicht eine große Masse anzusprechen vermöge.11 Vantongerloo bezeichnete das Tafelbild sogar als eine vom bourgeoisen System gehortete „Ausartung“ („dégénerescence“) der Kunst. Als Teil dieses Systems wurde die Kunst, so meinte er, zu einer Ware, deren Wert verhandelbar wurde. Beide betonten außerdem, dass einzig l’art mural fähig sei den Auswirkungen des Tafelbildes entgegenzuwirken.12
Neben dem Stimmengewirr aus dem Frankreich der 1930er Jahre, das das Ende des Tafelbildes ausrief, ertönte im Jänner 1948 die Stimme des amerikanischen Kunstkritikers Clement Greenberg.13 In The Situation at the Moment stellt er erstmals das herannahende Ende des Tafelbildes fest, da es von Werken, die sich über die Wand ausbreiten, Werken, deren großes Format eine nicht unwesentliche Rolle spielt, allmählich abgelöst wird. Im April desselben Jahres expliziert er in seinem gleichnamigen Aufsatz die Krise des Staffeleibildes und sieht diese als dem Bild inhärent an. Formale Kriterien sind es, die Greenberg zufolge das Ende des Tafelbildes herbeiführen. Erste Ausformungen der Krise erkennt er schon in der Malerei Édouard Manets, bei Claude Monet und Camille Pissarro kommen sie am deutlichsten zum Ausdruck. Diese Maler betonen, so Greenberg, mit ihrer Malweise als erste die Flachheit des Bildträgers und schaffen Bilder, die keine illusorische Tiefe mehr erzeugen wollen. Und genau das sieht er als (historische und damit überkommene) Hauptaufgabe des Tafelbildes an: An der Wand zu hängen und dadurch dieser Wand etwas zu verleihen was sie nicht hat, nämlich Tiefe. Das Tafelbild löste sich so von der Architektur, die es umgab, los. Das Erbe des Tafelbildes wird von einem Bild angetreten, das Greenberg als „decentralized, polyphonic all-over picture“ bezeichnet, einem Bild, das Flachheit betont und das sich eben nicht von seiner architektonischen Umgebung loslöst, sondern sich gleichermaßen mit dieser verbindet.14
In diesem Kontext betrachtet scheint die vierte Einzelausstellung Delaunays, im März des Jahres 1935, etwas verwunderlich. Unweit dem Louvre, in der Galerie des Magazins Art et Décoration eröffnet, trug sie den Titel Les revêtement muraux en relief et en couleur de Robert Delaunay. Gezeigt wurden jene Werke, die der Künstler selbst als Reliefs bezeichnete.15 Er präsentierte sie – wie Tafelbilder – in einem geschlossenen Raum, in einem institutionellen Rahmen.16 Gips, Kasein, Sägespäne und andere Materialien verarbeitete Delaunay für seine Reliefs. Der Schriftsteller Jean Cassou stellte in seinem in der März-Ausgabe des Magazins Art et Décoration erschienenen Aufsatz, welcher gewissermaßen als Begleittext zur Ausstellung gesehen werden kann, fest, dass diese Materialwahl es Delaunay ermöglichte, die Werke sowohl in einem geschlossenen Raum als auch der Witterung ausgesetzt zu präsentieren. Sie sollten in enger Verbindung mit der Architektur stehen und dieser nicht mehr nur „éléments exteriérieurs, superflus, ornamentaux“ sein, sondern als mit der Wand gleichberechtigt verstanden werden.

Abb. 2: Robert Delaunay, Fenêtres simultanées sur la ville, 1ère partie, 2ème motif, 1ère réplique, 1912, Öl auf Leinwand und Fichtenholz, 46 x 40 cm, Hamburg, Kunsthalle.
Die Motive der Reliefs sind, so Cassou, schon seit jeher in Delaunays Werk aufzufinden.17 Am deutlichsten wird dies, wenn man die Reliefs mit den Werken der Serie Rythmes sans fin, welche zur gleichen Zeit entstanden sind, vergleicht. Auch die Werke dieser Serie sind bestimmt von Kreisformen, welche an einer Achse angeordnet sind.18 Diese einfachen geometrischen Grundformen würden Cassou zufolge „les grandes figures célestes où s’exprime le cosmos“ evozieren.19 Die hier formulierte Metapher einer Verbindung von Delaunays Motiven mit dem Kosmos trifft wohl auch auf Relief Blanc, das später entstand, zu. Die weißen Schwingungszentren lassen den Eindruck von Planetenkonstellationen entstehen. Dass das Werk rein aus der Farbigkeit der verwendeten Materialien lebt und daher weiß ist, stellt eine Seltenheit nicht nur innerhalb Delaunays gesamten Schaffens, sondern auch innerhalb der Reliefs dar, da nur wenige der Reliefs monochrom sind. Diese maximale Präsenz von Weiß ist in Anbetracht Delaunays Frühwerk ebenso erstaunlich, war doch dieses bestimmt durch die Farbigkeit des prismatisch gebrochenen Sonnenlichts.20 Das Licht ist hier in Relief Blanc in seinem ursprünglichsten Zustand zu sehen: Es ist weiß. Aus dem weißen Licht, aus dem Ursprung, differenzieren sich die Bildobjekte21 heraus. Bildobjekte, die Kreise und Halbkreise sind und von Gilles Deleuze, in seinen knappen Ausführungen zu Delaunay, als „les pures figures de la lumière“ bezeichnet werden.22 Und diese Figuren entstehen, Deleuze zufolge, weil: „[…] la lumière est mouvement, la lumière est production“.23
Relief Blanc ist eines von insgesamt vier Reliefs, die, folgt man dem von Guy Habasque erstellten Werkverzeichnis, schon vom Künstler mit einem Rahmen versehen wurden. Sind die beiden Werke mit dem Titel Rythme en Relief, die im Zeitraum von 1930 bis 1931 entstanden, Habasque zufolge von einem weißen, zwei Zentimeter breiten Rahmen umgeben, ist der Rahmen bei Relief noir avec des cercles de couleur und Relief Blanc einer, der als „cadre biseauté“, also als abgeschrägter Rahmen, bezeichnet wird.24 Einen solchen abgeschrägten Rahmen verwendete Delaunay bereits bei einem wesentlich früheren Gemälde. Schon 1912 kommt er zum Einsatz. Fenêtres simultanées sur la ville, 1ère partie, 2ème motif, 1ère réplique (Abb. 2) wird allgemein als eines der ersten Bilder der Fenster-Serie gesehen.25 Delaunay bezeichnet diese Serie als Wendepunkt in seinem eigenen Œuvre und schreibt von ihr als „[…] une série qui ouvre vraiment ma vie artistique.“26 Sie schließt unmittelbar an die ihr vorangegangenen Serien wie La Tour oder La ville an, ja scheint sie ihre Bildobjekte, wie den Eiffelturm oder die Fenster der Häuser der Stadt, sogar in einer Serie zu fassen.27 Der Rahmen von Fenêtres simultanées sur la ville, 1ère partie, 2ème motif, 1ère réplique ist anders als noch von Werner Hofmann behauptet, nicht flach, sondern auf solche Weise abgeschrägt, dass die Leinwand auf oberster Ebene zu liegen kommt.28 Bildobjekte, wie die Fenster unten in der Mitte, sind auf dem Rahmen platziert. Es ist somit nicht nur die Farbe oder die Malweise – wie es etwa bei den Rahmen Georges Seurats der Fall ist –, die sich auf dem Rahmen befinden, sondern sind es eben auch Bildobjekte. Der Rahmen muss daher schon hier als wesentlicher Teil des Werkes und nicht mehr bloß als Beiwerk begriffen werden.29

Abb. 3: Robert Delaunay, Relief noir avec des cercles de couleur, 1930–1932, Öl, Gips und Sand auf Sperrholz, 46 x 38 cm, Privatsammlung.
Bei Relief noir avec des cercles de couleur (Abb. 3), das mit 46 x 38 cm wesentlich kleiner ist als das Relief Blanc, handelt es sich um eine der frühesten Reliefarbeiten. Auf einer schwarzen Sperrholzplatte sind entlang einer schrägen Achse, die die diagonale Achse des Werkes selbst bildet, insgesamt fünf Kreisformen angeordnet. Dabei handelt es sich um zwei große Kreise, die sich schneiden und in denen sich drei kleinere Kreise befinden. Der große Kreis rechts oben wird von dem rechten Bildrand angeschnitten. Er ist links von der Achse türkis und rechts davon in einem Rosa-Ton gehalten. Um den inneren Bereich des Kreises legt sich, ihn konturierend, ein dünnerer Kreis, der links von der Achse orange und rechts von der Achse rot ist. Der zweite große Kreis ist durchgehend in einem hellen Orange gehalten und wird von dem unteren Bildrand beschnitten. Ein kleiner Kreis ist in die Schnittfläche der zwei großen Kreise eingeschrieben. Er ist links von der Achse gelb und rechts davon blau. Sein Mittelpunkt bildet zugleich die Mitte des Werkes. Ein links hellgrüner und rechts türkisfarbener Kreis befindet sich rechts oberhalb des zentralen kleinen Kreises. Links unterhalb von ihm ein Kreis, der links von der Achse rot und rechts davon gelb ist. Delaunay differenziert zwischen den Schwarztönen innerhalb der kleinen Kreise mittels der Materialwahl. Im rot/gelben und im grün/türkisen Kreis ist jeweils das Kreissegment rechts von der Achse mit schwarzem Sand bestreut, im mittleren gelb/blauen Kreis das Kreissegment links von der Achse. An diesen Stellen bekommt das Schwarz eine andere, fast schon samtige Qualität, wodurch die rhythmische Bewegung der Kreise betont wird. Das Material bekommt dadurch eine darstellende Qualität und Delaunay zeigt so Wechselwirkungen zwischen Bildvehikel und Bildobjekt auf. Diese wiederum sind es, die innerbildlich jene Verbindung und Einheitsbildung zum Ausdruck bringen, welche auch zwischen Wand und Werk bestehen sollte.
Bei allen drei Werken führt die Beschaffenheit des Rahmens dazu, dass der Bildträger – sei es wie bei den Fenêtres die Leinwand oder die Sperrholz- beziehungsweise Metallplatte der Reliefs – an die BetrachterInnen herangerückt wird. Dieses Entgegenkommen des Bildvehikels hin zu den BetrachterInnen wird im Fall des Relief Blanc auch noch durch die Erhebungen und dreidimensionalen Objekte verdeutlicht. Für beide Reliefs bedeutet der Rahmen aber auch eines: Sie nähern sich einerseits, durch die zur Wand hin abgeschrägte Form, an die Wand an, heben sich aber zugleich von ihr, mit der sie doch gleichberechtigt sein sollten, ab. Der Rahmen erfüllt also gewissermaßen eine Scharnierfunktion zwischen Tafelbild und art mural und ermöglicht dem Werk, sich dem fensterartigen Eindruck, den ein klassisches Tafelbild zu suggerieren versucht, zu widersetzen. Das Werk selbst ist nicht eins mit der Wand, die es letztlich trägt, sondern befindet sich vor ihr. Es kann an jeder beliebigen Wand neu aufgehängt werden, es ist beweglich. Der Rahmen unterbindet aber auch die formal in den Werken angedeutete Expansion der Bildobjekte: Er setzt dem Werk seine eigene Grenze. Bedenkt man die Farbe der Wand, an der diese Reliefs hingen und präsentiert wurden – eine Wand, die vermutlich weiß war – so ist das Sich-Absetzen des Werkes von ihr im Fall von Relief noir avec des cercles de couleur ein besonders prägnantes.30 Der Rahmen ist schließlich braun und nicht wie bei Relief Blanc weiß gehalten. Das Werk wird dadurch als autonomes, von der Wand unabhängiges markiert. Die Heteronomie wird negiert. Beide Reliefs scheinen also eine Sonderstellung innerhalb der Konzeption der Werkgruppe der Reliefs einzunehmen. Dieser Umstand wird für Relief Blanc umso deutlicher, wenn man Relief Blanc mit dem zweiten Relief desselben Titels aus dem Jahr 1935 vergleicht. Dieses soll im Folgenden als Grand Relief Blanc (Abb. 4) bezeichnet werden.

Abb. 4: Robert Delaunay, Relief Blanc, 1935, Gips und Kasein auf Metall und Holz, 300 x 180 x 3,5 cm, Centre Pompidou, Paris.
Mit 300 x 180 cm ist dieses Werk die größte der Reliefarbeiten und kann mit Delaunays eigenen Worten aus demselben Jahr tatsächlich als eines der „grand ouvrages muraux“ bezeichnet werden. Es ist nicht gerahmt. Dieselben Materialien wie für sein ein Jahr später datiertes Relief Blanc, Gips und Kasein, hat Delaunay hier verwendet. Materialien, die Delaunay selbst wie folgt bezeichnete: „[…] des matériaux nouveaux qui transforment le mur, non seulement extérieurement mais dans sa substance même.“31 Die Materialwahl ist es, mittels derer Delaunay die Synthese von Werk und (tragender) Wand herstellen wollte. Die grobgekörnten Stellen in beiden Werken sind jene, wo Kasein zum Einsatz kam. Die Verwendung dieses Materials ist es wiederum, die die Verbindung zur Malerei beziehungsweise der Wandmalerei betont. Das aus Milch gewonnene Kasein wurde unter anderem als Bindemittel verwendet und kam in der Wandmalerei, beispielsweise in der Michaeliskirche in Hildesheim, zum Einsatz. Ebenso ist Gips Bestandteil von Wandmalerei und kann als Putz, beispielsweise bei der Leimfarbenmalerei, zum Einsatz kommen.32
Auch wird durch den Vergleich besonders deutlich, dass der Ursprung der Komposition von Relief Blanc im Grand Relief liegt. Die Schwingungszentren sind auch hier in eine Ellipse, in das Weltenei, eingeschrieben.33 Die Ausführung der Ellipse ist aber im Relief Blanc wesentlich subtiler. Jene zwei Zentren, die sich in Relief Blanc in der linken Werkhälfte an einer schrägen Achse entlang befinden, sind im Grand Relief Blanc in der rechten unteren. Jenes Zentrum, welches von der Ellipse geschnitten wird, befindet sich hier links unten und wird ebenso von der Ellipse geteilt. Die Komposition von Grand Relief Blanc wurde doppelt – zunächst horizontal, dann vertikal – gespiegelt, verkleinert, letztlich gerahmt und zu jener von Relief Blanc. Bei Relief Blanc kann also von einer Variation auf Grand Relief Blanc gesprochen werden.
Die Hinwendung der KünstlerInnen zu l’art mural soll ihre Werke als Teil eines großen Ganzen, als Teil der Architektur erscheinen lassen. Es soll eine neue Einheit, in der alle künstlerischen Formen Gleichberechtigung erfahren, entstehen. Der Bezug zur Architektur – sowohl bei Grand Relief Blanc als auch bei Relief Blanc – ist nicht zuletzt durch die Dimensionen gegeben, entsprechen doch die Maße von Relief Blanc ungefähr denen einer Türe. Die Werke implizieren so auf gewisse Weise eine architektonische Umgebung. Dabei handelt es sich wohl um eine Architektur – und das sei an dieser Stelle nur kurz angemerkt –, die selbst, sowohl innen als auch außen, in einer Farbe erstrahlt, nämlich in Weiß. Der Gegensatz zwischen Relief Blanc und der Architektur wird aber nicht aufgehoben. Das Werk arbeitet als Widerstand zwischen Autonomie und Grenzüberschreitung, ist es doch außerdem von einem Rahmen umgeben, der zwischen ihm und der ihn umgebenden Architektur zu vermitteln versucht, aber das Werk zugleich als für sich stehend markiert und gewissermaßen an eine institutionelle Struktur bindet.
Auch auf der formalen Ebene wird das Spannungsverhältnis zwischen in sich geschlossenem Werk und Orientierung auf die Umgebung hin gehalten. So wird ein Hinausstrahlen des zweiten Zentrums über den Bildrand hinaus angedeutet und ermöglicht dem Werk außerhalb des Bildträgers gleichsam weitergedacht zu werden. Die Bewegungen und Beziehungen, die zwischen den Schwingungszentren existieren, deuten ebenso auf eine Expansion hin und lassen den Eindruck entstehen, dass es unendlich erweitert werden könnte. Das Werk soll als großes Ganzes aufgefasst werden, was nicht zuletzt auch auf Grund seiner Maße verdeutlicht wird. Zugleich versucht es auch keinesfalls mehr eine illusorische Tiefe zu erzeugen. Ganz im Gegenteil wird es Teil des Betrachterraumes. Das Relief nähert sich so dem an, was auch für Greenberg die Nachfolge des Tafelbildes ausmacht. Doch geschieht diese Annäherung nur in kleinen Schritten, denn die Ellipse, welche die Komposition bestimmt, macht das Werk zu einem in sich abgeschlossenen Ganzen. Waren es formale Kriterien, die für Greenberg ausschlaggebend waren um das Ende des Tafelbildes definieren zu können, so sind es formale Kriterien, die Relief Blanc weiterhin als ein solches bestimmen lassen. Das Relief ist eben nicht „decentralized“ wie das Greenberg’sche Nicht-mehr-Tafelbild. Die Bewegungen können nicht aus der Ellipse ausbrechen. Die Wiederholungen und Rhythmisierungen sind auf Ewigkeit auf der Bildfläche gefangen. Man könnte meinen, sie wären zu Stein erstarrt. Delaunays Malerei hat sich in Relief Blanc einem Fossil anverwandelt, das als Tafelbild verweilt, ein Tafelbild ist, trotz allem.
1 Mein herzlicher Dank für zahlreiche Gespräche und wertvolle Hinweise gilt Wolfram Pichler. Christoph Chwatal, Franziska Figerl, Wenzel Kersten und Iris Kiesenhofer danke ich für die kritische Lektüre und zahlreiche Anmerkungen zum Text.
2 Die Verdichtung gestaltet sich folgendermaßen: Die fünf, ebenso erhabenen, konzentrischen Kreise um das zweite Zentrum, werden mehrfach unterbrochen: Links von der Achse von dem linken Bildrand, an dem sie nicht abschließen, und unten ebenfalls links von der Achse, von fünf konzentrischen Viertelkreisen, welche von der Achse weggehend sie überlagern. Diesen antwortet rechts der Achse ein grobgekörntes Feld in Form eines Viertelringsegmentes, welches die Kreise ebenso bedeckt. Unterhalb der fünf konzentrischen Viertelkreise befindet sich ein viertelringsegmentförmiges Feld, das in seiner Oberflächenbeschaffenheit sowie seiner Form gleich ist wie jenes Feld rechts von der Achse, welches die konzentrischen Kreise des zweiten Zentrums bedeckt. Links an die fünf Viertelkreise angrenzend schließt dieses Feld rechts an den Beginn der dritten Halbkugel an, mit der zugleich die schräge Achse endet. Diesmal ist, an der Achse entlang versetzt, die rechte Hälfte der Halbkugel erhaben. Diese ist aber, anders als die zwei anderen im Bild vorhandenen Körper, nicht von konzentrischen Kreisen umgeben.
3 Vgl. Guy Habasque, Catalogue de l’œuvre de Robert Delaunay, in: Pierre Francastel, Du cubisme à l’art abstrait, Paris 1957, S. 294 – 303.
4 Vgl. Annegret Hoberg, Schwarzes Relief mit farbigen Kreisen, in: Peter-Klaus Schuster (Hg.), Robert Delaunay und Deutschland (Kat.), Köln 1985, S. 382.
5 Vgl. Georges Vantongerloo, Le groupement abstraction et l’art mural, in: Edition catalogue critique du Salon de l’art mural, Juni 1935, n.p. sowie Amédée Ozenfant, Mur d’abord, in: Edition catalogue critique du Salon de l’art mural, Juni 1935, n.p. Beides abgedruckt in: Angela Lampe (Hg.), Robert Delaunay, rythmes sans fin (Kat.), Paris 2014, S. 51.
6 Vgl. Sabine Kricke-Güse/Ernst-Gerhard Güse, Einleitung, in: Ernst-Gerhard Güse (Hg.), Reliefs, Formprobleme zwischen Malerei und Skulptur im 20. Jahrhundert (Kat.), Bern 1980, S. 14.
7 Réginald Schoedelin, Responsabilité de l’artiste [Vortragstext], in: Europe, n°166, 15. Oktober 1936, S. 282 – 283. Abgedruckt in: Lampe 2014, S. 51.
8 Etwa zeitgleich wie in Frankreich gewinnt ‚l’art mural‘ auch in den USA und in Mexiko große Bedeutung. Besonders in New York wird die Wandmalerei durch das Federal Art Project, dessen Bestreben es war, die hohe Arbeitslosigkeit zu reduzieren, gefördert. Die in Mexiko aktiven Muralisten wurden ebenfalls staatlich gefördert: Ihre Werke sollten einheits- und identitätsstiftend wirkend. Siehe dazu u.a. Romy Golan, Muralnomad. The paradox of wall painting. Europe 1927 – 1957, New Haven/London 2009, sowie Antonio Rodriguez, A history of Mexican mural painting, London 1969.
9 Vgl. Pascal Rousseau, ‚Je fais la révolution dans les murs‘, l’abstraction monumentale de Robert Delaunay, in: Angela Lampe 2014, S.107 – 108.
10 Pierre Francastel, Robert Delaunay. Du Cubisme à l’art abstrait, Paris 1957, S. 233 – 234.
11 Vgl. Walter Grasskamp, Die weiße Ausstellungswand, in: Wolfgang Ullrich/Juliane Vogel, Weiß, Frankfurt am Main 2003, S. 35.
12 Vgl. Albert Gleizes, Art mural, in: Edition catalogue critique du Salon de l’art mural, Juni 1935, n.p. sowie Vantongerloo 1935, n.p. Beides abgedruckt in: Lampe 2014, S. 51.
13 Schon ein Jahr vorher thematisiert Jackson Pollock die Problematik, die dem Tafelbild innewohnt. In seiner Application for Guggenheim Fellowship schreibt er, er wolle ein Werk malen, das groß und zugleich beweglich sei und das sich zwischen ‚art mural‘ und Tafelbild ansiedeln ließe. Vgl. Jackson Pollock, Application for Guggenheim Fellowship, in: Pepe Karmel, Jackson Pollock. Interviews, Articles, and Reviews, New York 1999, S. 17.
14 Vgl. Clement Greenberg, The Situation at the Moment, in: John O’Brian (Hg.), Clement Greenberg. The collected essays and criticism. Volume 2 Arrogant Purpose 1945–1949, Chicago/ London 1986, S. 192 – 196 sowie Clement Greenberg, The Crisis of the Easle Picture, in: O’Brian 1986, S. 221 – 225.
15 Vgl. Habasque 1957, S. 366.
16 Über die Hängung der Werke in der Ausstellung ist im Spezifischen nichts bekannt. Der Titel der Ausstellung selbst betont aber den Bezug zu ‚l’art mural’, was wiederum, neben der Materialwahl selbst, expliziert, dass die Werke für eine Öffentlichkeit – und eben nicht nur für einen geschlossenen Raum – bestimmt seien.
17 Jean Cassou, R. Delaunay et la plastique murale en couleur, in: Art et décoration, revue mensuelle d’art moderne, März 1935, S. 98.
18 Siehe dazu auch Marie Merio, Relief Blanc, in: Lampe 2014, S. 36.
Domitille d’Orgeval-Azzi schreibt zu den Rythmes sans fin, dass Mittels der Wiederholung des Motivs Delaunay die Grenze der Leinwand zu überwinden versucht. Selbiges lässt sich eben auch für Relief Blanc feststellen. Vgl. Domitille d’Orgeval-Azzi, La posterité de Robert Delaunay, in: Lampe 2014, S. 128.
19 Cassou 1935, S. 98.
20 Zur Bedeutung von Licht und Farbe siehe u.a. Max Imdahl, Zu Delaunays historischer Stellung, in: Max Imdahl/Gustav Vriesen, Robert Delaunay, Licht und Farbe, Köln 1967, S. 71 – 74.
21 Die hier und in weiterer Folge verwendete bildtheoretische Terminologie ist jene von Wolfram Pichler und Ralph Ubl vorgeschlagene, die mit „Bildobjekt“ das bezeichnet, was das Bild zu sehen gibt, im Gegensatz zum „Bildvehikel“, der materiellen Struktur auf der die Bildobjekte erscheinen. Vgl. Wolfram Pichler/Ralph Ubl, Bildtheorie zur Einführung, Hamburg 2014.
22 Gilles Deleuze, Foucault, les formations historiques. Vorlesung vom 12. November 1985, 2. Teil der Transkription von Annabelle Dufourcq. URL: http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=415 [12.06.2017].
23 Deleuze 1985.
24 Vgl. Habasque 1957, S. 295 und 301.
25 Zu dieser Einordnung innerhalb der Serie siehe unter anderem: Johannes Langner, Zu den Fenster-Bildern von Robert Delaunay, in: Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen 7, 1962, S. 67 – 82. Es war Langner, der, sich auf eine Notiz Delaunays berufend, erstmals die Platzierung des Werkes an erster Stelle der Serie argumentiert hat.
26 Francastel 1957, S. 87.
27 Zum Verhältnis der Fensterserie zu jenen die vor ihr entstanden, siehe unter anderem Langner 1962.
28 Werner Hofmann, Zu einem Bild Robert Delaunays, in: Ders., Bruchlinien, Aufsätze zur Kunst des 19. Jahrhunderts, München 1979, S. 98.
29 Nähere Ausführungen zur Bedeutung des Rahmens bei Delaunays Fenêtres simultanées sind (im Rahmen einer Masterarbeit) in Vorbereitung.
30 Zur Entwicklung der weißen Wandfarbe im Ausstellungskontext siehe u.a. Grasskamp 2003. Grasskamp (S. 52) zufolge steht diese Entwicklung mit der Hängung von rahmenlosen Bildern in Beziehung.
31 Robert Delaunay, Réponse à l’enquête ‚Où va la peinture?‘, in: Commune, n°21–22, Mai und Juni 1935, n.p. Abgedruckt in: Lampe 2014, S. 135.
32 Vgl. Kurt Wehlte, Werkstoffe und Techniken der Malerei, Ravensburg 2000, S. 271, S. 422 und S. 429.
33 Insgesamt ist zu beobachten, dass das Motiv des Welteneis ein wiederkehrendes in Delaunays Reliefs ist. Siehe dazu die Abbildungen der Werke in Cassou 1935.