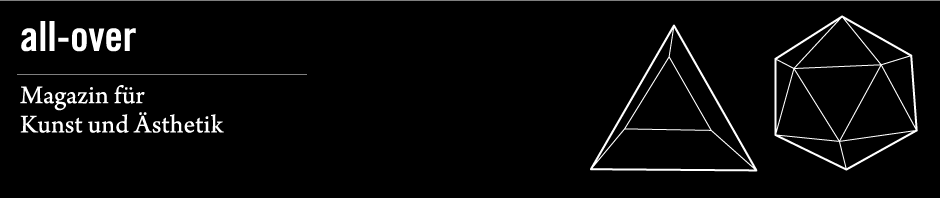Boris Groys veröffentlichte im Katalog der Secession, erschienen anlässlich der Ausstellung David Claerbout. Diese Sonne strahlt immer (3. Mai bis 17. Juni 2012), einen Aufsatz mit dem Titel Film im Kunstraum1. Die Ausstellung versammelte im Hauptraum der Secession fünf Filmarbeiten Claerbouts, die ohne Blackbox gezeigt wurden, wodurch alle fünf Filme zur gleichen Zeit zu sehen waren. Der Großteil der Arbeiten zeichnete sich durch ungewöhnliche Filmlängen aus – so dauert der Film Bourdeauxpieces 14 Stunden und überschritt damit die Öffnungszeiten der Secession. Groys’ Aufsatz widmet sich dem breiten Thema „Medienkunst im Museum“, wobei Groys in der steten Zunahme von Videoinstallationen (bzw. insgesamt Medienkunst) eine – im Allgemeinen – positiv zu bewertende Tendenz sieht. Er beschreibt in seinem Aufsatz die Rezeptionssituation im Kino als rückständige Kontemplation, die einen immobilisierten Asketen hervorbringt2 und kontrastiert diese mit Videoinstallationen (im Museum), die einen „freien und zugleich analytischen Umgang mit dem Kino- und Videobild“3 ermöglichen und das Publikum aktivieren. Der Aufsatz erschien auf Deutsch erstmals 2003 in Groys’ Aufsatzsammlung Topologie der Kunst4 und wurde für die Ausstellung in der Secession 2012 adaptiert. Dem gesamten Text liegt die These zugrunde, dass sich in Videoinstallationen die Dichotomie zweier Modelle der „Kontrolle über die [Rezeptions-] Zeit“5 aufzuweichen beginnt: zwischen die „Immobilisierung des Bildes im Museum“, die eine zeitlich unbegrenzte Rezeption zulässt, und die „Immobilisierung des Zuschauers im Kinosaal“6 treten nach Groys Videoinstallationen, in denen beide Pole, Bild und RezipientIn, in Bewegung sind. Die Videoinstallation ist so also zwischen unbegrenzter Kontemplation und Autonomieverlust durch Unbeweglichkeit, zwischen Tafelbild und Kino angesiedelt. Nach Groys versetzt diese Situation, deren Elemente – Bild und BetrachterIn – nun beide in Bewegung sind, „den Besucher der Installation in den Zustand des Zweifels und der Ratlosigkeit“.7 Doch genau diese Ratlosigkeit ist bei Groys positiv besetzt, da sie einen aktiven, reflektierten Umgang mit der Situation verlangt und nicht wie das Kino einen passiven, unreflektierten Asketismus befördert.8
In Hinblick auf die bei Groys formulierte, positive Bewertung der „Aktivität der RezipientInnen“ ist schon vorab zu bemerken, dass diese in einem gesellschaftspolitischen Kontext zu sehen ist. Denn bei einer wie auch immer gelagerten Verteilung von Aktivität und Passivität geht es, so Jacques Rancière, um eine Unterwerfung unter Herrschaftsstrukturen, die eine Aufteilung verlangt in „jene, die eine Fähigkeit besitzen und jene, die sie nicht besitzen.“9 Wenn Groys beschreibt, dass RezipientInnen in Videoinstallationen analytische Strategien für einen reflektierteren Medienumgang erlernen können, da sie sich aktiv zur Installation verhalten müssen, deklariert er sie als diejenigen, die diese Fähigkeit nicht besitzen und demnach erst erlernen müssen. Eine Konfrontation mit offenen und variationsreichen Situationen ist nach Groys kennzeichnendes Merkmal dieses Medienumgangs. Groys schreibt hierzu: „Der ästhetische Wert der Medieninstallation im Museum besteht also vor allem darin, die Unübersichtlichkeit, die Ungewissheit, die fehlende Kontrolle des Betrachters über die Zeit der eigenen Aufmerksamkeit […] explizit zu thematisieren.“10 Und weiter: „Auf verschiedenen Ebenen der Zeitökonomie zwingen also die Medieninstallationen den Betrachter, Entscheidungen in Bezug auf sein Kontemplationsverhalten zu treffen, die ihn zugleich – zumindest tendenziell – zu keiner abschließenden Betrachtung führen können.“11 Dadurch sei man stets aufs Neue angehalten zu reflektieren und werde so zu einem/einer aktiveren RezipientIn, der/die aus dem vormals passiven Verhalten, eingeübt durch das Kino, heraustreten könne. Eine Kritik der Passivität der RezipientInnen im Kino impliziert eine Distanz zwischen Aktivität und Passivität. Mit Rancière stellt sich jedoch in erster Linie die Frage, „ob nicht gerade der Wille, die Distanz abzuschaffen, erst die Distanz schafft?“12 Der Aufsatz von Groys steht in dieser mittlerweile langen Tradition, die in der (progressiven) Kunst die Aktivierung von RezipientInnen ortet und sie einer älteren, „passiven“ Rezeptionsform gegenüberstellt. Groys’ Artikel ist exemplarisch, da die Wiederveröffentlichung auf die andauernde Aktualität dieser Aktivierungsanrufung verweist (eine Debatte, die vor allem im Bereich der Performance und der partizipativen Kunst lebhaft geführt wird) und der Text die „aktive Rezeptionssituation“ als positive Form offen einer negativ bewerteten „passiven Rezeption“ entgegenstellt. Es ist demnach interessant, Groys in seiner Argumentation hinsichtlich „aktiver und autonomer“ RezipientInnen zu folgen, um zu sehen, welcher Begriff von Aktivität hier stark gemacht wird und was die treibende Kraft sein könnte, aktiv und reflektiert mit Medieninstallationen umzugehen. Während Groys den Begriff der Passivität mit der Rezeptionssitation im Kino kurzschließt, steht seinem Kino-pessimistischen Zugang die Kino-optimistische Sichtweise von Walter Benjamin und Siegfried Kracauer emphatisch gegenüber. Auch wenn zwischen diesen Positionen mehr als siebzig Jahre liegen, scheint es interessant, ausgehend von Kracauers Idee einer potenziellen Sprengkraft des Kinos, die Vorstellung der „Aktivierung der ZuschauerInnen“ innerhalb zeitgenössischer Videoinstallation zu beleuchten – nicht zuletzt angesichts der Tragweite, die sowohl Groys als auch Benjamin und Kracauer dem Verhältnis von Film und Gesellschaft zuschreiben.
Benjamin und Kracauer und ihr Verhältnis zum Kino
Was Theodor W. Adorno „Kulturindustrie“ nennt, wird bei Benjamin und Kracauer mit „Massenkultur“ bezeichnet. Der Unterschied liegt nicht nur im Begriff. Verkürzt beschrieben sieht Adorno den gesellschaftlichen Verfall in der Kulturindustrie ausgedrückt, wohingegen Kracauer und Benjamin unter anderem in der Massenkultur, Kracauer insbesondere im Film, ein revolutionäres Potenzial sehen, das den „notwendigen Umschlag“13 vorzubereiten vermag. Weshalb dem Film diese zentrale Stellung zukommt, lässt sich mit Benjamin durch seine Wirkung auf die Wahrnehmung der Menschen erklären. Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume ändert sich die Sinneswahrnehmung der Menschen; sie ist „nicht nur natürlich, sondern auch geschichtlich gewachsen.“14 Die Masse richtet sich auf die Realität aus, so wie die Realität auf die Masse. Massenkultur bzw. das Kino als Teil einer größeren Unterhaltungsmaschinerie ist demnach ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Realität, in der die Masse einerseits konstituiert wird, aber auch selbst formenden Charakter besitzt, oder wie Benjamin schreibt: „[Der Massenbewegungen] machtvollster Agent ist der Film.“15 Der gegenseitige Bezug von Kino und Gesellschaft lässt sich dann einige Seiten später nochmals nachvollziehen, wenn Benjamin beschreibt, dass die zerstreute Masse das Kunstwerk in sich versenke (nicht wie umgekehrt bei der Malerei, in die sich der Einzelne während der Kontemplation versenkt), dass also ein wechselseitiges Verhältnis zwischen Masse und Kino bestehe.16 Zerstreuung meint hier Ähnliches wie bei Kracauer, auch wenn weder Benjamin noch Kracauer eine klare Definition geben; der Begriff bezeichnet einerseits das „Durcheinander der Welt“ und die „Unordnung der Gesellschaft“ und meint andererseits das Bedürfnis der Massen in dieser Welt, Ablenkung von dieser zu suchen, also sich zu zerstreuen. Im Kino als möglichem Ort der Zerstreuung der Masse wird die Summe der Reaktionen der Einzelnen zu einer Reaktion des Publikums mittels einer im Kino gegebenen simultanen Kollektivrezeption verschmolzen – der Einzelne ist Massenteilchen und nicht Individuum. In der Kollektivrezeption versenkt die Masse nicht nur das Kunstwerk in sich, sondern auch die Masse kann sich in dieser Rezeptionssituation verändern, denn, so merkt Benjamin an: „Indem sie [die RezipientInnen] sich kundtun, kontrollieren sie sich.“17 Benjamin und Kracauer vermuten also eine Mobilisierung der Masse durch sich selbst, angeleitet durch das Kino.
Die Zerstreuung gelangte in den Filmvorführungen der 20er-Jahre, insbesondere in Metropolen wie Berlin, zu einem Höhepunkt; Kinovorführungen wurden zunehmend zu „Gesamtkunstwerken der Effekte“, in die man sich wie in den Blick durchs Kaleidoskop versenken konnte. Diese Filmvorführungen richten sich explizit an die Masse und sind so als Massenkultur beschreibbar (in der Masse sieht Kracauer alle, vom Bankdirektor bis hin zur „Stenotypistin“, versammelt).18 Massenkultur zeichnet sich durch eine Hinwendung zum rein Äußerlichen aus, denn das Bedürfnis der Masse nach Zerstreuung verlangt eine intensive Effektmaschinerie. Vielschichtige, differenzierte „Kunstereignisse“ treten zunehmend in den Hintergrund und es wird „dem Oberflächenglanz der Stars, der Filme, der Revuen, der Ausstattungsstücke […] Vorzug gegeben.“19 In dieser reinen Äußerlichkeit tritt die Masse in ihren Eigenschaften greifbar zutage – die Zerstreuung wird erlebbar, oder wie Kracauer schreibt: „Die zerstückelte Folge der splendiden Sinneseindrücke bringt seine [des (Berliner) Publikums] eigene Wirklichkeit an den Tag,“ denn die Filmvorführungen seien ein ähnlich äußerliches Gemenge „wie die Welt der Großstadtmasse“.20 Es ist also festzuhalten, dass sich die Situation, in der die Masse mobilisiert werden kann, im Kino abspielt, an dem Ort, an dem Groys reine Passivität durch Immobilität ortet. Einen der wesentlichsten Vorzüge des Kinos als Massenkulturphänomen sieht Kracauer in der Möglichkeit der Massenreflexion. Je eher sich die Menschen als Teil einer Masse empfinden bzw. wahrnehmen, indem sie gemeinsam ihre Lebenssituation medial vermittelt wiedererleben, umso eher kann diese Reflexion einen Prozess der Emanzipation in Gang setzen.21 In der Masse vereinigen sich unzusammenhängende Teile zu einem Ganzen, dessen Einheit allerdings bloß suggeriert wird – diese nur scheinbare Verbindung eines ungeordneten Ganzen, und damit der eigentliche gesellschaftliche Zerfall, können durch das Kino erfahrbar werden. Durch filmische Mittel wie die Großaufnahme oder die Hervorhebung kleiner Details bis hin zur Darstellung banaler, alltäglicher Situationen, die unzusammenhängend aneinander gereiht werden, wird die Form des Daseins als unbeherrschtes Durcheinander sichtbar – man kann im Kino also die eigene Situation in medial vermittelter Form wieder erleben und sich der eigenen Handlungsmöglichkeiten gewahr werden. Benjamin führt diesen Punkt näher aus; für ihn kommt dem Film eine doppelte Funktion zu. Einerseits wird „die Einsicht in die Zwangläufigkeiten vermehrt, von denen unser Dasein regiert wird“, gleichzeitig besitzt der Film durch Großaufnahme und Zeitlupe die Möglichkeit, uns „eines ungeheuren und ungeahnten Spielraums […] zu versichern“. Und weiter: „Unsere Kneipen und Großstadtstraßen, unsere Büros und möblierten Zimmer, unsere Bahnhöfe und Fabriken schienen uns hoffnungslos einzuschließen. Da kam der Film und hat diese Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zehntelsekunde gesprengt.“22 Die Argumentation zielt bei Benjamin und Kracauer somit auf Ähnliches: Durch das Kino kann man sich der einschließenden Kraft der Welt gewahr werden und gleichzeitig neue Formen der Aneignung erfahren. Indem der Film gesellschaftliche Einschließungsmechanismen sowie noch nie dagewesene Blickwinkel auf diese zu zeigen vermag, hat er also gleichzeitig das Potenzial, die Sprengung dieser „Kerkerwelt“ herbeizuführen. Im Kino öffnet sich dieser Prozess für die Masse. So wohlwollend Kracauer die Möglichkeiten des Kinos auch beschreibt, so sieht er doch den Leerlauf des Kinos und seines revolutionären Potenzials, denn Zerstreuung sei nur wahrnehmbar, wenn sich nicht der Schein einer „gewachsenen Schöpfung“23 über das Durcheinander stülpe, sondern gerade der Zerfall der Einheit spürbar werde. Indem in den revueartigen Filmvorführungen zur Zeit Benjamins und Kracauers jedoch die Tendenz besteht, die Stücke der Zerstreuung immer wieder zu einer vermeintlichen Einheit zusammenzusetzen und so eine gewachsene Einheitlichkeit vorzutäuschen, bleibt, so die Kritik, die Zerstreuung zu wenig wahrnehmbar, um fassbar zu sein.24 Um Sprengkraft zu erlangen, muss der Film viel eher in radikaler Form auf Zerstreuung abzielen und so den Zerfall entblößen. Auch wenn das Kino aufgrund kommerzieller Strukturen die Zerstreuung kaschiert, bleibt die Annahme aufrecht, dass das Kino zumindest potenziell gesellschaftspolitische Sprengkraft besitzt. Die aufgezeigte Argumentation Benjamins und Kracauers ist für die Untersuchung zeitgenössischer Videoinstallationen insofern relevant, als sie mindestens zwei Aspekte hervortreten lässt: Zum einen wird die wahrnehmungs- und damit realitätskonstituierende Eigenschaft des Mediums deutlich, und darüber hinaus wird dem bei Groys als passiv beschriebenen (Massen-) Publikum ein Erkenntnispotenzial zugesprochen. Was Groys als passives „über sich ergehen lassen“ beschreibt, trägt mit Benjamin und Kracauer gelesen mindestens die Bedingungen für gesellschaftspolitisches Handeln in sich, da die ZuschauerInnen ihrer eigenen Position als (potenziell) Handelnde gewahr werden.
Die Möglichkeit des freien Gedanken
Nach Groys ist „der Kinobesucher seiner Freiheit, seiner Autonomie vollständig beraubt“ und kann sich daher dem Film auch bedingungslos hingeben, denn er muss sich von Anfang an damit abfinden, eine gewisse Zeit unbeweglich im Dunklen zu verbringen.25 Die Bewegung des Filmbildes ersetze dabei das Denken und die Sprache der RezipientInnen, die also nicht nur physisch, sondern auch geistig gefesselt werden.26 Diese Unbewegtheit werde lediglich durch die bewegten Bilder kompensiert,27 denen die KinobesucherInnen in einer Situation der absoluten Ohnmacht ausgeliefert seien. Das Filmbild entwickle sich, während der/die BetrachterIn passiv bleibe.28
Auch Benjamin konstatiert, dass durch die stetige Veränderung der Bilder im Film kein Raum für Gedanken bleibt. Dies ist zentral und Auslöser für die viel zitierte „Chockwirkung”29, oder schlicht die Fähigkeit des Films, einen ganz und gar „zu fesseln“. Und auch Kracauer beschreibt die Erregungen der Sinne als so dicht, dass zwischen ihnen kein Gedanke mehr auftreten könne,30 oder wie Benjamin Georges Duhamel zitiert: „Die beweglichen Bilder haben sich an den Platz meiner Gedanken gesetzt.“31 Benjamin und Kracauer sehen im Gegensatz zu Groys jedoch gerade darin die Möglichkeit, auf etwas gestoßen zu werden – indem man nicht unmittelbar einwirken und die Situation dadurch erstmal „nur“ sehen kann, eröffnet sich die Möglichkeit, sich der eigenen potenziellen Handlungsmacht gewahr zu werden, sowie die Masse als gesellschaftliche Struktur (an-) zu erkennen. Groys ist recht zu geben, wenn er darauf hinweist, dass die Situation im Kino eine einschließende ist, doch steht dieses Faktum in keinem Zusammenhang mit Aktivität und Passivität, sondern verweist viel eher auf veränderte Gegebenheiten, denn im Kino ist es eben diese geschlossene Situation, in der die Sprengkraft des Mediums wirksam werden kann – die Masse im Kino erlebt als Kollektiv die einschließenden Mechanismen.
Von Benjamin wissen wir, dass sich die Masse auf die Realität ausrichtet, sowie die Realität auf die Masse, und dass Kultur Teil dieses Geflechts ist. In Groys’ Fall handelt es sich hier jedoch viel eher um die Einzelnen, und nicht mehr um die Masse. Denn in der Videoinstallation agieren Einzelne und kein Kollektiv. Hierbei ist wesentlich, dass die Filmerfahrung individualisiert wird.32
Der Zuschauer im Kino ist Teil eines Publikums; der Betrachter der kinematographischen Installation ist aufgrund seiner physischen Bewegungsfreiheit sowie aufgrund einer konstitutiv unvertrauten, weil vor Ort je einzigartigen: einzigen Präsentationssituation, auf sich gestellt.33
Damit ist einer der zentralen Unterschiede zwischen Kino und Videoinstallation benannt: das Verhältnis von Einschließung und Offenheit sowie von Masse und dem selbstverantwortlichen Einzelmenschen. Diese Differenz erinnert an die von Deleuze konstatierte Unterscheidung zwischen Disziplinar- und Kontrollgesellschaft, in der nunmehr der Fokus auf dem Einzelnen und nicht mehr auf der Masse liegt.34
Der Einzelne ist aktiv
Groys’ Lob der Aktivität fußt auf einem strengen und außerordentlich negativ besetzten Begriff von Passivität, der auch die Kontemplation miteinschließt. Er exemplifiziert diesen Begriff von Passivität an mehreren Stellen seines Textes; vor allem körperliche Ruhe – Groys nennt hier im Gegensatz zu Benjamin und Kracauer die Rezeption eines Kinofilms – wird dabei mit Passivität gleichgesetzt. Er belegt seine These der „geistigen Immobilität“ im Kino mit Gilles Deleuzes geistigem Automaten – was jedoch eine Verkehrung der deleuzianischen Idee dieses Automatismus darstellt. Denn weit davon entfernt, gedankenlos und nur gefesselt zu sein, ermöglicht der geistige Automatismus das Vordringen in undenkbare Gebiete und eröffnet damit die Option, sich selbst zu überschreiten. Es ist bei Deleuze gerade die Möglichkeit, nicht zu reagieren, sich also aus einem steten Zwang zur Aktion loslösen zu können, die Raum für das Denken gibt. Eine ähnliche Situation haben wir bei Benjamin und Kracauer gesehen, die unter der oberflächlichen Stillstellung eine umso tiefere Bewegung orten. Noch deutlicher wird Groys’ spezielle Sicht auf Aktivität versus Kontemplation, wenn er beschreibt, dass man mit einem Buch aktiv umgehen könne:„Er [der Leser] bestimmt den Ort der Lektüre, deren Rhythmus usw.“35 Der Kinofilm gilt in Groys’ Verständnis von Aktivität als überholt und passiv, da man die eigene (räumliche) Position nicht wählen kann. Im Gegensatz dazu bekomme der/die RezipientIn innerhalb der Videoinstallation die Möglichkeit, die gesamte Situation der Präsentation wahrzunehmen – „die Videoinstallation säkularisiert [damit] die Bedingungen der Filmvorführung.“36 Generalisierend beschreibt Groys Videoinstallationen als Filmpräsentationen, bei denen man sich frei im Raum bewegen und darüber hinaus die gesamte technische Apparatur sehen kann. Die Videoinstallation lege ihre eigene Situation offen und lasse jede Form der Bewegung zu.37 Juliane Rebentisch beschreibt in Ästhetik der Installation eine Tendenz zeitgenössischer Videoinstallationen, die durch die Offenlegung der Darstellungsmittel (Kamera, Licht, Schnitt etc.) sowie der Präsentationsformen (dunkler Raum, Projektion auf eine vertikale Leinwand etc.) eine steigende Produktivität der RezipientInnen forcieren und damit eine „selbstreflexiv-performative, das heißt ästhetische Bezugnahme auf die (Gegenstände der) Installation in Gang“38 setzen. Für Groys scheinen nur durch solche Videoinstallationen ZuschauerInnen autonom zu werden. Durch den freien und analytischen Umgang mit dem Filmbild schult der/die KünstlerIn die RezipientInnen im Umgang mit Medien und hat dadurch Vorbildcharakter. Was es hier zu lernen gibt, ist beachtlich: „An […] Beispielen lernt der Betrachter nämlich, dass alle Parameter des Medienkonsums variabel sind – und beginnt, auf seine eigene Weise die Medienbilder zu dekontextualisieren, zu rekontextualisieren, zeitlich anders zu platzieren usw.“39 In diesem Punkt sind sich Kracauer, Benjamin und Groys einig: im Kino bzw. der Videoinstallation wird der/die RezipientIn für ein Leben außerhalb dieser spezifischen Situation geschult. Geht man mit Benjamin davon aus, dass sich Sinneswahrnehmungen im Lauf der Zeit medienbedingt verändern,40 stellt sich in Hinblick auf Videoinstallation erneut die Frage, was hier geschult wird. Groys’ Text stellt einen offenen Bezug zwischen der Situation der RezipientInnen in der Videoinstallation und dem gesellschaftspolitischen Leben außerhalb des Museums her. Er beschreibt diese Situation wie folgt:
Plötzlich findet sich der Museumsbesucher in einer Lage wieder, die wie das außermuseale Leben aussieht, d.h. wie ein Ort, von dem bekannt ist, dass man an ihm alles Wichtige verpasst: Im sogenannten Leben hat man nämlich immer das Gefühl, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.41
Auch Benjamin und Kracauer sahen eine enge Verbindung zwischen dem Kino und der Welt außerhalb des Kinos, weil im Kino die in der Außenwelt verborgenen, weil verinnerlichten, einschließenden Mechanismen der Masse offenbar werden konnten. Videoinstallationen verweisen auf eine gänzlich andere Situation, die sich durch Offenheit und Variationsreichtum auszeichnet, gleichzeitig aber auch den Anspruch stellt, sich gegenüber dieser Offenheit aktiv zu verhalten und stets neue Strategien im Umgang mit ihr zu erlernen.
Die Freiheit, die eigene Situation zu kontrollieren
Sollte man im sogenannten „Leben“ tatsächlich „immer das Gefühl [haben], zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein“42, so lassen sich Videoinstallationen Groys zufolge als eine Parabel auf eben diese Situation verstehen. Verlässt man eine Videoinstallation nach selbstbestimmter Zeit und kehrt später wieder zurück, so hat man unweigerlich das Gefühl, etwas Wichtiges verpasst zu haben und nicht mehr zu verstehen, worum es eigentlich geht.43 Da man dadurch gerade seine je eigene Rezeptionssituation kreiert, ist man auch innerhalb dieser Rezeption auf sich allein gestellt.44 Groys’ Formulierung „falsche Zeit/falscher Ort“ suggeriert zweierlei: erstens, dass es auch einen richtigeren (aber keinen richtigen?) Ort gibt und zweitens, dass man versäumt hat, ihn aufzusuchen. Videoinstallationen verweisen also gleich auf eine doppelte Distanz, die es zu überwinden gilt – hin zu einem reflektierteren Medienkonsum und einer gesteigerten Aktivität –, und den KünstlerInnen wird die Position von PädagogInnen zugewiesen. Der individuelle Medienumgang, der hier nach Groys geschult wird, sowie die offene Situation scheinen paradigmatisch für jene Form der gesellschaftlichen Verhältnisse, die Deleuze mit dem Begriff der Kontrollgesellschaft beschreibt:
Die Kontrolle ist kurzfristig und auf schnellen Umsatz gerichtet, aber auch kontinuierlich und unbegrenzt, während die Disziplin von langer Dauer, unendlich und diskontinuierlich war. Der Mensch ist nicht mehr der eingeschlossene, sondern der verschuldete Mensch.45
Verschuldet, da man sich in einem Prozess stets unabgeschlossenen Lernens befindet. Wir haben die begrenzenden Einschließungsmechanismen, die geschlossenen Milieus zugunsten steter Modulationen verlassen,46 in denen man „nie mit irgendetwas fertig wird.“47 Auch wenn sich Schuld bei Deleuze auf Kapital bezieht, scheint die Überlegung interessant zu sein, ob Schuld nicht auch die treibende Kraft innerhalb von Videoinstallationen ist und der Umgang mit einer durch Schuld getriebenen Aktivität das, was es eigentlich zu lernen gilt. Die Aktivierung der RezipientInnen als immanente Bestandteile der Installation ergibt zwangsläufig eine Vielfalt an gleichwertigen Verhaltensmöglichkeiten. Gäbe es nur eine, säße man im Kino und wäre nach Groys Asket. Die RezipientInnen sind aufgefordert, aktiv zu reflektieren und zu wählen. Denn ähnlich des ständigen Versagens zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, steht man auch bei Videoinstallationen immer in der (Aufmerksamkeits-)Schuld, da die Möglichkeiten, wie man sich zur Installation verhält, unbegrenzt sind. In der Gewissheit, die aufzubringende Zeit pro Installation frei wählen zu können, daher aber auch zu müssen, stellt sich die Frage, wie viel Zeit einem die Rezeption der Installation wert ist. Wenn man nie mit etwas fertig wird, so schlussfolgert auch Juliane Rebentisch, hat man unter Umständen auch die stete Angst, etwas zu verpassen.48 In Videoinstallationen müsse man also anerkennen, so Groys, dass es „keine adäquate und zufriedenstellende Lösung geben kann.“49 Wie auch immer man sich zur Installation verhält, wie viel Zeit man auch aufbringt, „jede einzelne Entscheidung bleibt ein fauler Kompromiss.“50 Am Beispiel der eingangs erwähnten David Claerbout-Ausstellung in der Secession wird diese Möglichkeitsvielfalt und Unabgeschlossenheit besonders deutlich. Obwohl alle fünf Filme im selben Raum laufen und man sich zwischen ihnen frei bewegen kann, ist es dennoch nicht möglich, alle Filme während eines Ausstellungsbesuchs zu sehen, da die Spielzeiten die Öffnungszeiten übersteigen. Ein fauler Kompromiss bleibt daher jede Entscheidung aufgrund der schon angesprochenen Möglichkeitsvielfalt, die nach Groys’ Definition von Aktivität die Voraussetzung ist, überhaupt aktiv sein zu können. Es ist nicht mehr die Kerkerwelt, die es zu sprengen gilt, sondern ein offener Prozess, in dem man sich stets reflektierend verhalten muss, wobei das Gesamte wie beispielsweise die 14 Stunden von Bourdeauxpieces nie zu erreichen sein wird. Insofern ist es nicht mehr die einschließende, sondern die per se verschuldende Welt, die man hier erfährt. Schon Walter Benjamin konstatiert in seinem Fragment Kapitalismus und Religion von 1921 Schuld als eine der vier Säulen des Kultus. Er beschreibt Schuld als treibende Kraft; eine Schuld, die alles miteinschließt und „nicht zu entsühnen ist“51, da die Entsühnung selbst nicht vorgesehen ist. Es bräuchte ein stabilisierendes Moment – Benjamin schreibt über etwas „Sicheres“ –, um aus der Schuld heraustreten zu können, doch der Kultus zeichnet sich gerade durch die Absenz einer solchen Stabilität aus. „Der Kapitalismus ist vermutlich der erste Fall eines nicht entsühnenden, sondern verschuldenden Kultus.“ Und weiter: „Ein ungeheures Schuldbewusstsein, das sich nicht zu entsühnen weiß, greift zum Kultus, um in ihm diese Schuld nicht zu sühnen, sondern universal zu machen.“52 Oder mit Deleuze: „Der Mensch ist [eben] nicht mehr der eingeschlossene, sondern der verschuldete Mensch“.53 Und so gilt es, sich selbst kontinuierlich zu disziplinieren, zu reflektieren und das alles in dem steten Wissen, dass es zwar viele Möglichkeiten gibt, aber keine zielführende, da das Ziel nur noch als nicht zu erreichendes existiert. Es hat tatsächlich ein ironisches Moment, dass Groys diese auf einer ziellosen Möglichkeitsvielfalt basierende Aktivität so emphatisch anlobt. Denn was hier eingeübt wird, ist unter Umständen eine von „unentsühnbarer“ Schuld getriebene und damit eine nie enden wollende Aktivität.