Teil I[1]
Gawan Fagard traf Alexander Kluge am 20. Februar 2012 in dessen Münchner Wohnung in der Friedrichstraße. Anlass des Gesprächs war ein unvollendetes Filmprojekt zwischen Andrei Tarkowski (1931 – 1986) und Alexander Kluge (geb. 1932), in dessen Mittelpunkt die Akasha-Chronik von Rudolf Steiner (1861 – 1925) gestanden hätte. Steiner hatte zwischen Juli 1904 und Mai 1908 eine Reihe von Aufsätzen in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Lucifer-Gnosis publiziert, die seit 1939 auch in Buchform unter dem Titel Aus der Akasha-Chronik aufgelegt wurden.
Für Kluge und Tarkowski war dieses Buch stillschweigend die Gesprächsgrundlage, als sie sich im Dezember 1984 in West-Berlin trafen, um über eine mögliche Verfilmung des „Stoffes“ nachzudenken. Zwei Jahre später verstarb Tarkowski. Die geplante Kollaboration hinterließ nur eine marginale Spur in Form einer kurzen Erzählung, die Kluge in den zweiten Band seiner monumentalen Chronik der Gefühle aufnahm. Der Text gleicht zunächst einem Nachruf auf Tarkowski: „In einem Berliner Zimmer, das an eine Küche grenzte, saß (oder war hingesetzt von den befreundeten Seelen, die ihn versorgten) Andrei Tarkowski. Einer der wenigen Großen unter den Filmregisseuren der Welt, vom sowjetischen Filmverband verstoßen, in Hollywood unbekannt.“[2]
Das Gespräch hatten Dritte organisiert und so galt es zunächst einige Meinungsverschiedenheiten über die Produktionsbedingungen beizulegen. Kluge favorisierte einfache, unkomplizierte und vor allem kostengünstige Drehbedingungen; Tarkowski „[…] hatte dagegen im Sinn, dass die Dreharbeiten an einem herausgehobenen Ort, z.B. an Kreuzwegen zwischen Himalaya und Karakorum, d.h. auf tibetanischem Gelände, stattfinden sollten.“[3]
Das Gespräch verwickelte sich in die Diskussion möglicher Drehorte, Szenarien und Jahreszeiten. Es galt, gemeinsam den „Kairotopos rechter Orte und Zeiten“[4] zu ermitteln. Ein Brunnen, südlich von Neapel, den bereits Ovid erwähnte, sollte als Ausgangsszenario dienen. Ein Hinweis auf Tibet erwies sich als Übersetzungsfehler für gewisse Täler und Gletscher im Hindukusch. Von einer Besichtigung der Grenzflüsse Oxus und Jaxartes war die Rede. Kluge übersetzte Tarkowskis topologische Suche in die absolute Metapher des Gartens, des hortus conclusus. Diesen müsse man aber nicht unbedingt an der Pamirseite der Sowjetunion aufsuchen, wandte Kluge ein. „Dann müssen wir die Hindukusch-Seite wählen, die zu Indien gehört, antwortete Tarkowski. Allein das Himmelszelt über diesen trockenen Bergen, einige Quadratmeter Boden, die kein Mensch je betrat – das wären Bilder. Gegen die Planer von Moskau gerichtet.“[5]
„Wir können ebensogut“, entgegnete Kluge, „Elementares verfilmen: den ersten Windstoß des Herbstes, den längsten Moment des Winters, die Morgenröten, von denen jede verschieden ist. Wenn es bei Homer heißt: ‚Scharf wehend das Aug wie der Nordost’, dann ist das schwer zu verfilmen, weil ja das Auge weht und nicht der Wind. Das könnten wir aber im Kalkstein der Alpen und an der See weit im Norden eher filmen als bei einer Expedition in ein antikes Land, das weder Sie noch ich kennen.“[6]
Keine der beiden Expeditionen fand letztlich statt. Im folgenden Gespräch schreiben Kluge und Fagard eine Geschichte weiter, von der man zwar nicht genau sagen kann, wovon sie handelt, in der aber über Steiner und Tarkowski hinaus zunehmend deutlich wird, dass sie auf einer Metaebene eine Theorie der Imaginationen und des spekulativen (dialektischen) Bildes in der Moderne verhandelt. Die Rede ist von Ikonen und Youtube-Bildern, Vor- und Nachbildern, Ikonoklasten und Ikonodulen, und der Figur Steiners aus der jeweiligen Sicht Kluges und Tarkowskis. Beider Annäherung an Steiner unterscheidet sich von der affirmativen beziehungsweise ablehnenden Textlektüre der meisten Anthroposophen und Kritiker Steiners dadurch, dass für Kluge und Tarkowski die Erfahrung des Films über das zu Dokumentierende entscheidet.
Das folgende Gespräch sowie dessen Fortsetzung in der kommenden Ausgabe ist Teil einer Recherche für einen Spielfilm zweiter Ordnung[7], der weder das Ziel verfolgt ein unvollendetes Projekt im Nachhinein zu vollenden, noch die historische Konstellation des Berliner Gesprächs als solche dokumentiert, sondern sich vielmehr auf die Spuren einer Topologie begibt, deren Orte wohl selbst nur in der Erfahrung des Films und der kinematographischen Imagination hergestellt wurden.
Toni Hildebrandt
Gawan Fagard: Lassen Sie uns damit beginnen, über die Beziehung von Steiner und Tarkowski nachzudenken. Wie würden Sie die gegenseitige „Einflussnahme“ beurteilen?
Alexander Kluge: Das war mir zunächst rätselhaft als ich Tarkowski traf. Er ist ein hochindividueller Mensch. Ein großer Künstler ganz eigener Art. Wenn ich es nicht gewusst hätte, wenn es mir nicht von Haus aus gesagt worden wäre, hätte ich nicht vermutet, dass er sich für Steiner interessiert. Tarkowski ist sehr ernst in der Suche und mir hat es sehr gefallen, als er sagte, dass es in der Nähe des Vesuvs einen Eingang zu einer Höhle gibt, von der aus man in die Unterwelt käme. Nun weiß ich von Homer, dass Odysseus in der Nähe von Gibraltar den Eingang zu der Unterwelt fand.[8] Anderseits muss ich Ihnen sagen, dass dieses Gelände so etwa östlich von Neapel mit seinen Höhlungen schon sehr eigenartig ist. Unter der Lava befindet sich nicht das Herculaneum und Pompeji, sondern alles mögliche Andere und zwar nicht unter Lava, sondern unter dem Bett der Geschichte. Und das sind die Dinge, die Tarkowski in seinen Filmen immer wieder hervorhebt. Es gibt eine unsichtbare Welt. Die ist gegenwärtig.
Es gibt eine Grammatik der Bilder. Die Aktualität und die Momentaufnahme realisiert die Kamera fast von selbst. Das ist die Grundformel des Films, aber darin ist Vergangenheit und Zukunft, die Möglichkeitsform, der Konjunktiv – das Subjonctif. Daneben gibt es aber in der griechischen Antike noch die grammatische Form des Optativs. Meine Wünsche sind total antirealistisch und bilden eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit kann hart wie Beton sein, aber diese Wünsche sind eben auch hart wie Beton. Sie sind aber auch flexibel, plastisch, gummiartig, das heißt: Sie sind der Wirklichkeit überlegen.
Gawan Fagard: Dann findet man in der Unterwelt also sowohl etwas Hartes wie etwas Zartes?
Alexander Kluge: Ja, das sind zwei Eigenschaften, die der Ursprung der Materie mit Gewissheit hat, die wir gewissermaßen in unseren Zellen aufbewahren. Die Plastizität und Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns zum Beispiel. Da sitzen Milliarden Beamte hier oben und verkennen die Wirklichkeit total. Was diese Gehirnzellen tun und abbilden und als Zeichen setzen, hat nichts zu tun mit einem Sternenhimmel, mit einer Wand, einem Menschen oder einer andersartig verfestigten Konstellation. Evolutiv haben sich aber die gesammelten Irrtümer unserer Gehirne und die gesammelten verfestigten Verhältnisse außen so an einander gewöhnt, dass wir wahrnehmen – übrigens in der Figur des Blinden bei Homer etwas besser als im Falle eines Sehenden.
Gawan Fagard: Wäre das dann etwa vergleichbar mit Steiner, der sich als ein „Sehender“ verstand?
Alexander Kluge: Ja, davon versteht er etwas. Eine kritische Distanz fände ich hier unangemessen. Ich halte es für dogmatisch zu sagen: „Aha, hier an dieser Stelle ist er zu widerlegen, da flunkert oder übertreibt er… Wo hat er das her?“ Das ist vollkommen uninteressant. Für mich ist er zunächst einfach ein ahnungsvoller Poet. Das würde mir zunächst reichen. Er wäre dadurch sozusagen mit Kassandra ebenso verwandt wie mit einem Religionsstifter.
Gawan Fagard: Was bedeutet das dann aber für die Wirklichkeitserzeugung eines Bildes?
Alexander Kluge: Was ist „wirklich“? Wir Menschen sind auf eine „Wirklichkeit“ angewiesen. Da wir eine Haut haben, die uns zusammenhält; da wir ein Haus haben und die Vorstellung eines Gemeinwesens entwickeln, bilden wir gemeinsam eine Vorstellung von Wirklichkeit. Diese ist selbstverständlich eine Illusion, die nichts zu tun hat mit wirklichen Verhältnissen. Wenn sie einer Gehirnwäsche unterliegen, oder plötzlich irgend ein Absturz oder eine Katastrophe erfolgt, dann spürt man, wie diese „wirklichen Bilder“ erschüttert werden.
Jetzt gibt es also offenkundig viele Wirklichkeiten. Die subjektiven Wirklichkeiten haben ein anderes Aussehen, bilden andere Monster und Engel als die objektiven. Dieses Zusammenleben ist ein Art Konzert, das wir Wirklichkeit nennen. Ich hätte also keinerlei Schwierigkeiten, mit verschiedenen Wirklichkeiten umzugehen. Wenn ich mir also vorstelle, wie Steiner in der Adventszeit 1908 in Schweden einen Vortrag hält,[ix] dann folge ich zunächst diesem Vortrag und höre ihm heute zu. Das ist meine Umgangsform. Die Frage wäre dann, warum meine Neugier durch ihn so sehr angestachelt wird. Die Frage ist also nicht, ob er mich als Mathematiker überzeugt.
Der Gott Apoll ist aber sowohl der Gott der Musik als auch der Mathematik. Und er ist ein brutaler, erbarmungsloser Töter. Er tötet die elf Kinder der Niobe, oder wie viel es sind… Er ist aber auch ein Wahrsager, ein gnädiger Gott. Wir haben es also mit einer Vielfalt von Göttern zu tun, die in diesem einen Bild aufgehoben sind. Damit geht meines Erachtens Steiner um; Tarkowski auf seine Weise dann auch.
Gawan Fagard: Nun gibt es bei Tarkowski natürlich den Film. Das Dispositiv des Films hat ein Objektiv. Dadurch ergibt sich ein anderes Sehen; eine andere Form, die an bestimmte Gesetze gebunden ist.
Alexander Kluge: Es gibt aber keinen Film, der nicht außerhalb der Kadrierung wiederum etwas hat. An der Schnittstelle des Films, wo die eine Einstellung der anderen begegnet, setzt die Montage ein.
Gawan Fagard: Wie ließe sich das Verhältnis des nur Sichtbaren zu einem übersinnlich Unsichtbaren im kinematographischen Medium denken? Die Aufzeichnung der Kamera scheint vielleicht einem spirituellen oder übersinnlichen Sehen entgegen zu stehen.
Alexander Kluge: Ich bin mir nicht sicher. Sie sprachen ja eben von der Wirklichkeit. Die ist sozusagen die Konvention unserer Sinne, die wir durch die Sinne anderer Menschen auf das adaptieren, was wir glauben zu sehen oder zu hören; die wir eben als Außenhaut unserer Erfahrung benutzen. Es ist meines Erachtens so: Die Kamera verfügt hier über ein sogenanntes „optisches Unbewusstes“. Das ist ein Ausdruck von Walter Benjamin. Die Kamera nimmt etwas auf, was gegen den Gewohnheitsblick geht. Wir sind erstaunt, was wir sehen. Die Kamera hat sozusagen unsere Aufmerksamkeitsstruktur unterlaufen. Das ist die eine Seite.
Die zweite Seite ist, dass gewissermaßen ein Film an der Montagestelle ein drittes Bild erzeugt. Sie sehen etwas, das beeindruckt, und während noch der Eindruck läuft, entsteht ein anderes Bild. Dieses ist kontrastiv. In der Lücke, wo nichts ist, wo sozusagen nur der Widerspruch zwischen zwei Einstellungen existiert, da entsteht in der Vorstellung des Zuschauers ein drittes Bild. Das nennt man Epiphanie. Diese Epiphanie ist die Grundform des Ahnungsvermögens. Jeder Esoteriker weiß, dass die Epiphanie erlaubt, durch die Dinge hindurch sehen zu können. Das ist das, was der weise Mann tut, was er kann. Was übrigens jedermann kann. Kinder können es besonders gut. Kinder unter drei Jahren, nach Steiner, haben ein natürliches Verhältnis zur Epiphanie, zum Ahnungsvermögen. Die Poeten reaktivieren als Erwachsene diesen Blick.
Gawan Fagard: Das hat Tarkowski wohl auch gemeint wenn er sagte, die Kinder verstehen am besten meine Filme.
Alexander Kluge: Ja.
Gawan Fagard: In dem mit Tarkowski geplanten Projekt hatten Sie die Figur eines Landvermessers berücksichtigt, sicher ein ganz deutlicher Hinweis auf Kafka. Daneben gibt es aber auch den Garten, der sich einer Überlieferung nach im Hindukusch befand und den keiner je betrat. Der Garten und die imaginäre Geographie spielen auch eine ganz wichtige Rolle in Ihrem Gesamtwerk.
Alexander Kluge: Es gibt ja diesen Garten wirklich – oder die Möglichkeit des Gartens. Britische und russische Geographen hatten in der spannungsgeladenen Zeit des Krimkrieges in Afghanistan Landvermessung betrieben. Sie legten einen langen Streifen zwischen Russland und Indien, in dem man im Grunde nicht angreifen durfte. Dieses Land ist von Menschen fast unbetreten. Es ist selbst jetzt vom Bürgerkrieg und der Okkupation nicht betroffen. Davon handelt die Geschichte. Sie spielt an einem Ort, der von Menschen nicht „entweiht“ wurde. Dieser Ort ist noch die Natur. Viel Natur gibt es nicht auf der Welt.
Der zweite Punkt ist, dass man einen völlig unbekannten Ort auch als hortus conclusus verstehen kann; als einen geschlossenen Garten. Den würde man dort suchen können. Jetzt muss man aber einen Moment lang überlegen was Garten eigentlich heißt. Paradies heißt ja auf Persisch „Garten“. Das ist ein Garten Eden, wie er im Alten Testament beschrieben wird. Auf der einen Seite gibt es Wüste, die vom Planeten selbst erzeugt wird. Wenn es trocken ist, gibt es Wüste und es ist dann immer zu viel Sand und zu wenig Leben (obwohl viel Leben in der Wüste ist, man soll das nicht unterschätzen). Aber es ist auf jeden Fall nichts für Menschen auf Dauer.
Auf der anderen Seite gibt es den Dschungel. Da ist zu viel an Pflanzen, eine Fülle von Natur die gewalttätig ist. Dazwischen liegt aber noch der Acker. Der Acker ist fast nur nützlich und muss potenziert und gegen den Nachbarn abgegrenzt werden. Er ist störend für das Gemeinwesen, er ist gleichgemacht und er erodiert den Boden. Der Acker ist auch nicht das Schönste, wenn es auch das Nützlichste ist. Die gesamte landwirtschaftliche Revolution, von vor zehntausend Jahren bis heute, das ist der Acker.
Jetzt gibt es noch etwas ganz anderes. Das wäre dann der Garten. Der Garten entnimmt der Wüste etwas, profitiert mitunter vom Nutzen des Ackers und bändigt den Überfluss des Dschungels. Der Garten ist luxuriös. Im Central Park in New York zum Beispiel könnten Sie kein Büro aufmachen. Die Englischen Gärten stellen im Grunde die largesse, die Großzügigkeit dar. Das einzige was der Adel je Positives hervorgebracht hat. Dieser Aspekt des Gartens hat noch mal eine Struktur, an der Tarkowski und ich extrem interessiert sind. Der Garten der mittelalterlichen Klöster, im 12. Jahrhundert meinetwegen, das ist die Bildung überhaupt; eine Art Transferstelle, wo die Antike in der Barbarei ihre Stellung hält und von der Europa gelernt hat. Die Mönche pflegten den hortus conclusus, den geschlossenen Garten oder den Mariengarten, wo man nur solche Pflanzen hegte, die sozusagen nach Merkur, oder nach wem auch immer – nach im Grunde esoterischer Tradition – Heilung bringen konnten. Das sind Pflanzen, die der Jungfrau entsprechen, die auf der Mondsichel sitzt. Das ist entweder Diana oder die Mutter Maria. Wahrscheinlich beide. Das sind nicht alle beliebigen Pflanzen; keinesfalls eine Tulpe, sondern harmlose Pflanzen, Geheimpflanzen.
All das gehört zum hortus conclusus als einem umschlossenen Garten. Der Garten ist eigentlich der Kern der Bildung, der Kern dessen, was wir in uns tragen, was wir gemeinsam haben.
Gawan Fagard: Deswegen gibt es da auch Bücher.
Alexander Kluge: Absolut! Ein Buch ist ein Garten. In der Arche Noah waren eben nicht Tiere, sondern die Arche war eine Truhe mit Büchern und die kam an am Berg Ararat. Daher ist sie als eine Botschaft erhalten geblieben. Davon handelt auch Steiner, danach sucht er. Und so auch Tarkowski. Diese Botschaft findet man unter Umständen in Dingen, in Quellen, in Brunnen, nicht notwendigerweise in Büchern. Der spiegelnde Brunnen bei Neapel ist ein solches Buch. Was wir herumtragen seit vielen Millionen Jahren und wie wir unsere sechzehn Vorfahren mit uns herumtragen, das ist auch ein Buch: das genetische Buch. Ein sehr interessantes, wo lauter Mönche, die nicht sichtbar sind, Texte schreiben, kleine Veränderungen anbringen, über die Generationen hinweg. Das ist die Evolution.
Gawan Fagard: Dann gibt es noch die Sterne…
Alexander Kluge: …und die arbeiten. Die Sterne sind genau so lebendig wie wir. Stellen wir uns vor, was ein blauer Riesenstern wie der Sirius ist. Generös verströmt er sich in Millionen Jahren. Ein ganz kurzes Leben – und doch ganz riesenhaft. Nachdem er sich in einer Explosion verstreut hat, sammelt sich das Zerstreute neu und drei Sonnen gehen unter. Dann entsteht die Materie, aus der wir gebaut sind. Das ist schon eine ganz schöne Verklärung der Natur.
Man muss das vergleichen mit der Überlieferung, dass aus Ägypten ein Volk ausgewandert sei. Es wurden Steine im Boden gesetzt, damit man zurückfinden konnte und man außerdem auch wissen konnte, wo sich die Brunnen befinden. Diese Steine wandern dann bis nach Prag und daraus wird der Golem gemacht, 1348, als die Judenschlacht die Juden ausliefert. Dann sind die Steine also schon da und man kann einen Golem daraus machen. Das sind alles Wirklichkeiten!
Gawan Fagard: Aus dem kosmischen Gedächtnis.
Alexander Kluge: Es sind Überlieferungen, und ich habe jetzt extra mal von den Sternen bis zu einem Stein und bis zu einer Judenschlacht in Prag gesprochen – in Prag, wo jetzt auch ein Astronom sitzt und die Sterne schon wieder betrachtet. Das heißt, diese Sterne sind wirklicher als alles was wir sind. Das könnte man schon so behaupten. Tarkowski würde das wahrscheinlich nicht viel anders erzählen.
Gawan Fagard: Vielleicht können wir hier noch einmal einen Schritt zurück zum Garten gehen. Gibt es einen Unterschied zwischen dem normalen Garten, den Sie hortus conclusus nannten, und der Idylle, die im Griechischen als eidolon, also als ein „kleines Bild“ bezeichnet wird?
Alexander Kluge: Ich glaube, dass ein hortus conclusus nicht ein normaler Garten ist. Er ist als geschlossener Garten das Konzentrat der Idee des Gartens. Er hat eine ganze Menge seelischer Eigenschaften erhalten während er gestaltet wurde. Schloss Elmau oder der englische Garten sind so nicht ganz identisch. Klein sind diese hortus conclusus-Anlagen nicht, da sie ja untereinander verbunden sind. Stellen Sie sich nur 7000 Klöster vor, und unterirdisch fließt ein Strom. Dann haben Sie noch die Texte und auf der Rückseite des heiligen Testaments ist der Text Ovids, den derselbe Mönch schreibt. Also klein sind diese Bilder nicht.

Abb. 3: Unbekannter Deutscher Meister aus Westphalen, Jungfrau mit Kind
im Hortus Conclusus, ca. 1410, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza.
Vor allen Dingen: Was heißt „klein“? In YouTube sind Bilder von Minutenlänge enthalten, die mich sehr entzücken und die ich für Nachbilder der Minutenfilme um 1902 halte. Die Filmgeschichte kehrt so auf YouTube wieder. Wenn ich aber diese Bilder auf meinem Laptop mit unter die Bettdecke nehme, dann betrachte ich eigentlich ein briefmarkengroßes Bild, aber ich mache das Bild dennoch groß.
Deswegen haben wir in Venedig zum Beispiel Minutenfilme auf 65-mm vorgeführt. Zu Ehren von YouTube. Nach der Filmgeschichte ist es nun möglich, auch unter den vielen YouTube-Bildern einige wenige Glücksfunde zu machen. Auf dem Festival, wo sie hin gehören, werden sie einmalig große Bilder. Mit einem handtellergroßen Negativ. Das würde Tarkowski gefallen. Und wenn sie dann die Kerze auspusten in einem der Filme, dann ist der Docht, der nachglüht, mannsgroß. Und es ist keine Frage, ob dann der Beifall kommt – natürlich kommt Beifall, aber es ist auch wichtig, dass man so etwas kleines, ein eidolon, wie einen verglühenden Docht real in die Filmgeschichte einbringt. Insofern ist „klein“ und „groß“ eine Sache, die man unter dem Gesichtspunkt der Potenz sehen muss. Dieses Kleine kann ich mir groß vorstellen. Und das große Propagandabild eines Reichsparteitags ist nachträglich betrachtet so klein mit Hut.
Wenn wir von Garten sprechen, dann müssten wir auch vom Brunnen sprechen. Der Garten ist horizontal. Der Brunnen ist tief – tief, wie ein Bergwerk. Brunnen ist der Ausdruck Tarkowskis: „Brunnen der Götter“.
Gawan Fagard: Das hat er gesagt?
Alexander Kluge: Ja, das hat er gesagt. Das war es, nachdem wir forschen sollten. Solch ein Brunnen sieht nicht aus wie irgendeine Wasserstelle, wo ich mit einem Eimer Wasser schöpfe, sondern es ist der Spiegel, das Spiegelbild, das ist die Tiefe, das ist die Dunkelheit des Brunnens; und es ist die Erwartung, dass da ganz unten nicht nur eine Kröte sitzt. Es existieren dort Brunnenschätze und Durchgänge zu einer anderen Wirklichkeit. Wenn sie nicht glauben, dass das möglich ist, dann können sie mit Tarkowski nicht kommunizieren. Das setzt er voraus. Wenn ich mir vornehme, wie ein Naturwissenschaftler zu denken, wäre es doch dogmatisch zu sagen, „Das kann es nicht geben. Das kann er nämlich nicht wissen.“
Gawan Fagard: Da wir jetzt von den Naturwissenschaften reden, möchte ich noch einmal auf die Sterne zurückkommen – das kosmische Kino, wie Sie es in Ihren Geschichten vom Kino erwähnen.
Alexander Kluge: Das ist ja eine Tatsache. Felix Eberty, ein österreichischer Jurist, hatte einen sehr naheliegenden Gedanken.[x] Wenn das, was auf der Erde geschieht, als Licht abstrahlt, dann müsste es auf einem Nachbargestirn möglich sein, dieses Licht zu sammeln. Wenn zum Beispiel eine Photoemulsion in Form eines Planeten dort existiert, dann könnte das gefilmt werden. Dann könnte man, falls man diese Strahlung wieder zurückbekommt, zum Beispiel den Untergang der französischen Flotte vor Abukir erneut sehen. Einstein hat das sehr ernst genommen. Diesen Grundgedanken fand er sehr faszinierend und auch überzeugend. Er zagte lediglich mit dem Gedanken, dass man das Licht auch wieder zurückbekäme. Es ist unmöglich, dass wir in irgendeiner Zeit die Ereignisse zurückholen können und auf diese Weise sozusagen, wenigstens in der Betrachtung, in der Zeit reisen könnten. Diese Vorstellung ist aber nicht ganz stimmig. Wir wissen heute, dass die dunkle Energie eine negative Bewegung hat und sehr wohl in der Lage wäre, gegen die Schwerkraft gerichtet zu sein, ohne die Lichtgeschwindigkeit zu verletzen und die Dinge wieder zurückzubringen.
Gawan Fagard: Es sind also nicht die Dinge, die zurückgebracht werden sollen, sondern die Abbildungen.
Alexander Kluge: Ja. Die aufgenommenen Abbildungen hätten Eberty und auch durchaus meiner Neugierde gereicht. Das wäre ein universaler Film, eine ubiquitäre Präsenz, etwas was wirklich die Idee des Films potenziert.
Es gibt so ein paar Dinge, die ich Tarkowski noch gerne erzählt hätte: In 1,5 Millionen Kilometern hinter unserem Erdball gibt es einen Lagrange-Punkt, wo sich die Kräfte des Mondes, der Sonne und der Erde genau aufheben, sodass ein Himmelskörper oder ein Gegenstand genau stehenbleibt. So ziehen wir hinter uns her ein Fernrohr. Es handelt sich um eine Art Infrarot-Fernrohr, das extrem gekühlt sein muss, da es sich sonst selbst filmen und immer nur sich selbst sehen würde. Es müsste also kühler sein als die Hintergrundstrahlung von drei Grad Kelvin, die im Weltall die kältesten Punkte bildet. Das ist die Lebenszeit, dieses Gerät. Nur zwanzig Minuten am Tag innerhalb von 24 Stunden kann man den Kontakt damit aufnehmen. Es gibt gewisse Agenten dieses Geräts, also Physiker, die diese zwanzig Minuten nutzen, um das Ding wieder in Gang zu bringen. Denn das stockt manchmal – die Computer müssen resettet werden.[xi]
Das Zentrum unserer Galaxie, um die wir in 125 Jahren kreisen mit unserem Sonnensystem können wir optisch ja nicht sehen, aber mit Infrarot schon. Mit dem Gerät können Sie es sehen, es ist also imaginär. Da ist ein Auge, das anderes sieht als unsere Augen.
Unsere Augen würden Infrarot gar nicht erst wahrnehmen. Ein Mausauge würde etwas sehen, aber nicht in 1,5 Millionen Kilometer hinter uns herlaufend. Und dieses eigenartige Gerät, mit dem wir sozusagen elektronisch kommunizieren, verbindet uns mit Sternen, die wir sonst nicht sehen könnten – und so mit der ganzen weiten Welt des Infrarots.
Gawan Fagard: Das geht vorbei an aller Optik.
Alexander Kluge: Das geht über alle Teleskope hinaus. Vor allem deswegen, weil es was ganz anderes sieht.
Gawan Fagard: Genau, das ist eine andere Sehform.
Alexander Kluge: Und das ist dann wie das Auge unseres Planeten, der ja sozusagen selber ganz blind ist. Der ist schön, aber er ist eigentlich seiner Umgebung unkundig.
Gawan Fagard: Deswegen braucht man dafür den Menschen und das Kino.
Alexander Kluge: Diese Art von Kino kommt der Theorie von Eberty nicht nahe. Das ist ein ganz anderes Konzept, aber es bereichert es. Jetzt würden wir schon zwei Augen haben. Vom Eberty-Auge und davon, die dunkle Energie lesen können, die circa 70% der Substanz im Weltall ausmacht, hat zu Steiners Zeiten ja keiner gewusst. Die Vorstellung einer „dunklen Materie“, die vermutlich 30% davon ausmacht, und das x-Feld hätte Steiner mit dem „Äther“ benannt. Das impliziert, dass alles in einem Bett liegt und gehalten wird, als wäre es Gottes Hand. 70% bleiben da noch übrig als dunkle Energie, die die Galaxie vor sich hertreibt und in Gegenbewegung zur Gravitation läuft. Es wäre interessant, den Eberty zu rehabilitieren und Tarkowskis ahnungsvollen, neugierigen Instinkt zu reaktivieren.

Abb. 5: Rudolf Steiner, Die Bildung des menschlichen Ätherleibes aus dem Kosmos (Wandtafelzeichnung), aus GA 212, Vortrag vom 26.5.1922.
Gawan Fagard: In Solaris gibt es ja den Gedanken, dass, wie weit man auch reist im All, man immer wieder auf einen Spiegel stößt, mit seinem eigenen Selbst und seinem eigenen Bewusstsein konfrontiert wird. Und wie dieses Bewusstsein möglicherweise erweitert wird, wenn die Liebe dazu kommt. Die Hauptperson Kelvin muss sich mit ihrer unbewussten und unverarbeiteten Liebesgeschichte auseinandersetzen.
Alexander Kluge: Und er bringt seine Geliebte, wenn er sie nicht haben will, in die Umlaufbahn. Das heißt – das finde ich so phantastisch – dass Tarkowski einen fast zynischen und grotesken Blick (der zu Rabelais passt) gleichzeitig mit einer lebendig planetarischen Perspektive kombiniert. Steiner sagt ja: Unsere Erde war früher einmal ein Lebewesen und ist jetzt allmählich erkaltet. Das hätten wir versucht, darzustellen.
Nach meiner Methode kann man das immer nur indirekt darstellen. Da würde er mit mir übereinstimmen. Er würde schon erstmal versuchen ob man, wenn man lang genug wartet, es doch aufnehmen kann. Er ist handgreiflicher, direkter. Er ist ein ganz klein bisschen gewalttätiger, als es meinem Temperament entspricht.
Toni Hildebrandt studierte Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Philosophie und Romanistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar, der Universität Rom „La Sapienza“ und am „Istituto Italiano per gli Studi Filosofici“ in Neapel. Er war von 2010 bis 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter am NFS Bildkritik „eikones“ und ist im akademischen Jahr 2013/2014 Resident Fellow am Istituto Svizzero in Rom.
[1] Die Fortsetzung dieses Gesprächs folgt in einem zweiten Teil in der Ausgabe Nummer 7 von all-over im Herbst 2014.
[2] Alexander Kluge, Die Brunnen der Götter. Akasha-Filmprojekt mit Andrej Tarkowski, in: Ders., Chronik der Gefühle, Bd. 2., Frankfurt am Main 2004, S. 472 – 478, hier S. 472.
[3] Kluge 2004, S. 473.
[4] Herbert Holl, ‚[…] lang ist die Zeit, es ereignet sich aber / Das Wahre’: Ereignisgewässer in Alexander Kluges ‚Heidegger auf der Krim’, in: Nikolaus Müller-Schöll (Hg.), Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der Zeiterfahrung: Anspruch und Aporien, Bielefeld 2003, S. 269 – 294, hier 270 f.
[5] Kluge 2004, S. 477.
[6] Ebd.
[7] The Fountains of Gods (Arbeitstitel), ein Film von Jake Zervudachi, Pieter-Jan De Pue und Daria Belova mit Drehbuch von Gawan Fagard, Produktion Peter Krüger, Inti Films, Brüssel (in Vorbereitung).
[8] Vgl. Homer, Odysseus, 11. Buch, 90 – 118. Der „Eingang zur Unterwelt“, auf den Kluge hier anspielt, könnte auch verbunden werden mit Vergils Aeneas, wo die Hauptfigur den Eingang zur Hölle in Cunae, etwas westlich von Neapel findet. Vgl. Vergil, Aeneas, 6. Buch.
[9] Rudolf Steiner hielt nicht in der Adventszeit, sondern bereits im Februar 1908 eine Reihe von Vorträgen in Malmö, Uppsala und Stockholm.
[10] Anonym [Felix Eberty], Die Gestirne und die Weltgeschichte. Gedanken über Raum, Zeit und Ewigkeit, Breslau 1846. Für die Neuausgabe verfasste Albert Einstein ein Geleitwort, vgl. Felix Eberty/Albert Einstein/Gregorius Itelson, Die Gestirne und die Weltgeschichte. Gedanken über Zeit, Raum und Ewigkeit, Berlin 1923.
[11] Alexander Kluge redet hier über das sogenannte Herschel Space Observatory, ein im Jahr 2009 von der ESA entwickeltes Infrarotweltraumteleskop.






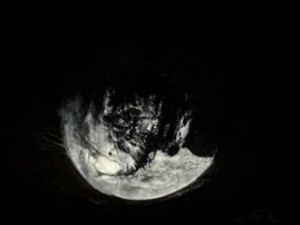







![Abb. 2: Théodore Géricault, Der verletzte Kürassier zieht sich aus dem Gefecht zurück (Studie) [Le Cuirassier blessé quittant le feu], 1814, Öl auf Leinwand, 55,2 x 46 cm, Brooklyn Museum, New York.](http://allover-magazin.com/wp-content/uploads/2014/03/Abb2-246x300.jpg)
![Abb. 3: Théodore Géricault, Der Kürassier von Waterloo [Le Cuirassier de Waterloo], 1822, Öl auf Leinwand, 71 x 59 cm, Privatsammlung, Paris.](http://allover-magazin.com/wp-content/uploads/2014/03/Abb3-244x300.jpg)


